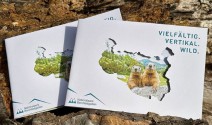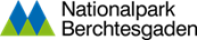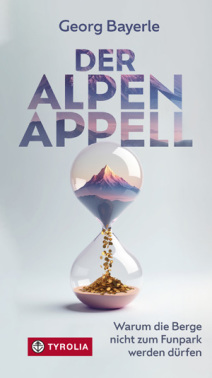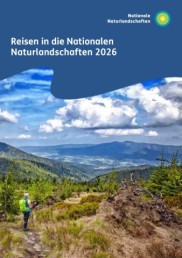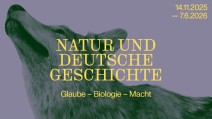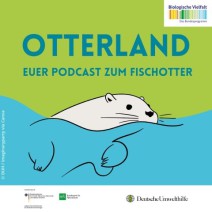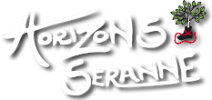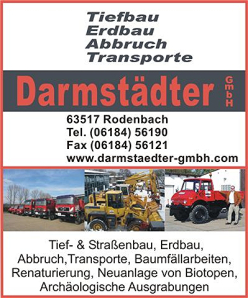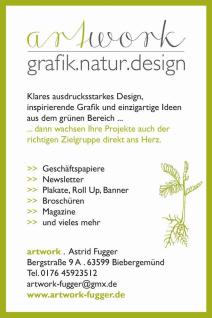9. August 2024
Die Sommerruhe der Herbstzeitlose
Main-Kinzig-Kreis. Eine ganz ungewöhnliche Pflanze: Die Herbstzeitlose. Sie ruht während des Sommers und zeigt ihre Blüten im Herbst. Doch die Pflanze schafft schon jahrelang Probleme in der Landwirtschaft und im Naturschutz. Darum engagiert sich die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA) für ihre Zurückdrängung.
In den heißen Sommertagen ruht man sich am liebsten aus, sei es zuhause oder im Urlaub. Doch nicht nur Menschen verbringen diese Zeit zum Schutz vor der prallen Sonne im Schatten, sondern auch die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale).
Ein außergewöhnlicher Lebenszyklus
Was die Herbstzeitlose zu einer besonders ungewöhnlichen Pflanze macht, ist ihr Lebenszyklus. Anders als die meisten Pflanzen bildet sie ihre Blätter und Blüten nicht zur selben Zeit. Ende März bis Anfang April sind nur die Blätter und die Samenkapseln zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt bildet die Pflanze die Tochterknolle, welche im Verhältnis zur Mutterknolle immer etwas tiefer im Boden ist. Somit kann die Knolle über die Zeit eine Tiefe von 25 Zentimetern erreichen. Außerdem sind zwei weitere Knospen an der Tochterknospe zu finden. Anfang des Sommers öffnen sich die ver-trockneten Samenkapseln. Ihre Samen haben sogenannte Elaiosome, Nährkörper, welche Amei-sen anlocken. Somit verbreiten die Ameisen die Pflanzensamen. Auch andere Tiere tun dies so-wie der Wind und landwirtschaftliche Geräte.
Schließlich geht die Herbstzeitlose in ihre wohlverdiente Sommerruhe. Ihre blassvioletten Blüten können erst im Spätsommer und Herbst gesichtet werden. Dies schafft einen auffälligen Kontrast in der Landschaft, da die Pflanzen auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen wachsen. Wenn der Winter kommt, sind keine Teile der Herbstzeitlosen mehr zu sehen. Die Pflanze ist nun in der Win-terruhe. Im Frühling fängt der Prozess erneut an.
Eine problematische Pflanze
Doch die Pflanze ist nicht nur in dieser Hinsicht ungewöhnlich, sie ist auch giftig. Die Herbstzeit-lose hat sich in den letzten Jahren vor allem in extensiv bewirtschafteten Flächen verbreitet. Ihr Giftstoff ist bleibt auch nach dem Trocknen wirksam, was das Heu als Tierfutter wertlos macht. Dies führt zur Nutzungsaufgabe, wodurch sie nicht nur für die Landwirtschaft problematisch ist, sondern auch für den Naturschutz, da die wertvollen Grünlandbestände verschwinden.
So wird auch die GNA nach der Sommerpause wieder ihre Rückdrängungsmaßnahmen fortset-zen, die Flächen kartieren und weiter Versuche mit Agrar-Robotern durchführen.
Quelle: Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA)