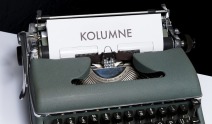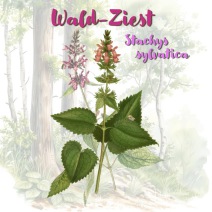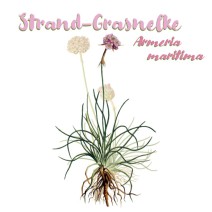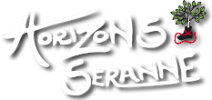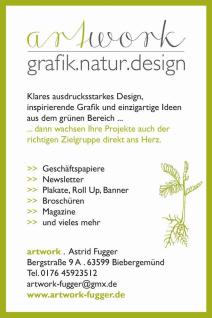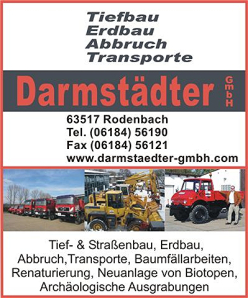NATUR Online Kolumne
Beiträge zu wichtigen Nachhaltigkeitsthemen unserer Zeit.
Die Beiträge stammen - wenn nicht anders angegeben - von Susanne Hufmann,
Biologin und Redakteurin NATUR Online.
Wilde Kinder braucht das Land
Tipps für ein neues Naturerleben
Längst ist es bekannt: Kinder, die gut klettern können, sind auch gut in Mathe, Physik, Chemie und Biologie. Kindern, denen frühzeitig Gelegenheit gegeben wird, Nähe zur Natur sowie zu Tieren und Pflanzen aufzubauen, entwickeln wichtige Metakompetenzen wie Emotionalität und Empathie, die die Grundvoraussetzungen für eine soziale und der Nachhaltigkeit verpflichteten Gesellschaftsordnung sind.
Alles nichts neues, mag man denken. Im Rahmen unserer Umweltbildungsprogramme wie
„Mit der Wasserforscherkiste auf Tour“ durften wir in den letzten Jahren viele Erfahrungen im Umgang mit sehr heterogenen Kindergruppen sammeln. Verknüpft mit Erinnerungen aus der eigenen Kindheit,
haben uns diese Eindrücke zu großen Befürwortern von mehr Naturnähe werden lassen. Denn sie zeigten, wie wichtig eine natürliche Umgebung für die Entfaltung seelischer, körperlicher und geistiger
Potenziale eines Menschen ist.
Und wie schädlich es ist, wenn Kinder nur noch in einer sterilen und von technischen Geräten
wie Smartphone, Computer und Fernseher dominierten Indoor-Umgebung aufwachsen, während Fischbäche und Froschtümpel, Insektenwiesen und Buchenwälder unerreichbar bleiben oder - wie in vielen Nationalpark-zentren und Naturkundemuseen heute üblich – lediglich als computer-animierte Welten die unermessliche Vielfalt der belebten und unbelebten Natur virtuell abbilden.
Dem als Entfremdung bekannten Phänomen wird leider immer noch – weder im Kindergarten noch in der Schule oder im Elternhaus - wenig bis gar nichts entgegengesetzt. Stattdessen nehmen psychosomatische Störungen bei Kindern und Jugendlichen stetig zu.
Sogar Depressionen, Angst- und Essstörungen greifen um sich. Schon jedes 5. Kind in Deutsch-land soll unter dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom leiden. Man fragt sich zu Recht, ob es sich nicht eher um ein Natur-Defizit-Syndrom handelt. Dabei bewegen wir uns weit entfernt von einer romantischen Sicht auf die Natur. Vielmehr belegen neuere Erkenntnisse der Neurologie und Hirnforschung, was unabdingbar ist für die gesunde Ausbildung einer humanen Persönlichkeit: Das Spielen mit und in der Natur.
Du könntest Dich verletzen! Dem Naturerleben, wie wir Älteren es aus unserer Kindheit noch kennen, stehen heute oft irrationale Ängste der Erwachsenen entgegen, die den kindlichen Aktionsradius stark einschränken. Dass Natur aber seit einigen Jahren zunehmend als ein Raum betrachtet wird, den man – aus der Angst heraus, man könnte etwas zerstören – besser nicht betreten sollte, ist eine Entwicklung, die sowohl dem behördlichen Naturschutz als auch dem Verbändenaturschutz zu verdanken ist. Naturschutzgebiete ganz dem Menschen zu entziehen
ist ebenso falsch wie die Natur zu weiteren Eventlocations einer erlebnishungrigen Gesellschaft auszubauen.
Wie wird aus einem kleinen Stubenhocker ein wildes Kind?
Machen Sie Ihr Kind neugierig auf die „Welt da draußen“. Erzählen Sie von Ihren eigenen Erfah-rungen in der Natur. Machen Sie Waldspaziergänge oder Ausflüge an einen Bach oder See. Planen Sie dabei immer genug Zeit für Entdeckungen und Abenteuer ein. Beginnen Sie mit Naturerlebnisspielen im Freien. Seien Sie ein gutes Vorbild und verzichten Sie beim Spazieren-gehen auf das Handy. Melden Sie Ihr Kind in einem Waldkindergarten oder einer Naturschutz-jugendgruppe an. Achten Sie dabei auf eine regelmäßige Teilnahme. Legen Sie im eigenen Garten kleine Wildnisecken und Blühwiesen zur Naturbeobachtung an. Vergessen Sie nicht, Ihrem Kind Zeit und Freiräume zu lassen. Sie werden schnell merken, dass auch Sie sich an die Tage erinnert fühlen, in denen Sie selbst die Natur entdeckt haben, als Sie noch Kind waren, ein wildes Kind wohlgemerkt!
In einer Handvoll Erde existieren mehr Lebewesen als Menschen auf diesem Planeten.
Kein Torf in den Topf - Moore und Klima schützen
Klimarelevante Nachhaltigkeitstipps
Klimaschutz fängt schon im Kleinem an. Jede(r) Einzelne kann und sollte darüber nachdenken. Denn selbst die Wahl der Blumenerde, die für
Balkonpflanzen oder die Gartengestaltung ver-
wendet wird, ist relevant für unser Klima. Wie das?
Wer einmal mit offenen Augen durch einen Baumarkt oder ein Gartencenter geht, wird schnell feststellen, dass die meisten Angebote, die als Blumenerde deklariert sind, hauptsächlich Torf enthalten. Doch was ist Torf eigentlich? Und was bringt Torf meinen Pflanzen? Für die meisten Blumenliebhaber ist die Antwort wahrscheinlich überraschend. Torf ist der Stoff, aus dem unsere Moore bestehen. Und den Pflanzen bringt er erst einmal NICHTS!
Moore sind weltweit bedroht, inzwischen sehr seltene Ökosysteme und als Lebensräume für ganz besondere Tier- und Pflanzenarten von immenser Bedeutung. Damit nicht genug: Moore sind außerordentlich klimarelevant, denn sie speichern das Treibhausgas Kohlendioxid.
Die Nutzung der vor etwa 12.000 Jahren natürlich entstandenen Moore begann schon ganz früh. Moorstandorte wurden zur land- und forstwirtschaftlichen Zwecken systematisch durch Gräben entwässert und genutzt, Torf wurde abgebaut, getrocknet und als Brenn- und Heizstoff verwendet. Obwohl bekannt ist, dass die Folgen dieser Eingriffe unumkehrbar sind, geschehen sie heute noch überall und zu jeder Zeit auf unserem Planeten. Zurück bleiben ein gestörter Wasser-haushalt, Bodenerosion und der Verlust einer ursprünglichen und einzigartigen Moorvegetation.
Dazu zählt in erster Linie das Torfmoos, das entscheidend für die Entstehung von Mooren ist. Denn die kleinen wurzellosen Pflänzchen können unbegrenzt wachsen. Die Basis unter Wasser stirbt dagegen aufgrund des Luftabschlusses ab. Aus den sich unvollständig zersetzenden Pflanzenresten entsteht der allseits beliebte Torf.
So weit so gut. Aber wussten Sie, dass dieser Prozess extrem langsam abläuft? Dass Torf durchschnittlich nur 1 Millimeter pro Jahr wächst? Aber dabei dauerhaft Treibhausgase bindet?
Dass Torf wider besseres Wissens immer noch sehr gerne im Garten und auf dem Balkon einge-setzt wird, hat zugegebenermaßen gleich mehrere gute, teils verführerische Gründe:
Torf ist leicht und einfach zu transportieren. Torf speichert viel Wasser, ohne dass Pflanzen-wurzeln an Sauerstoffmangel leiden. Torf hat einen niedrigen pH-Wert und kann mit Hilfe von Kalk an unterschiedlichste Pflanzenbedürfnisse angepasst werden. Und zu guter Letzt: Torf ist nähr-stoffarm, weshalb ihm Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphate zugesetzt werden können, aber auch müssen, denn ohne Nährstoff kein Pflanzenwachstum.
Doch das begehrte Gut wird knapp. Die globalen Vorräte können nur noch wenige Jahrzehnte unseren Bedarf decken. Hinzu kommt, dass der Torfabbau große Mengen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre freisetzt. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die heute schon unter dem Klimawandel leidenden Moorgebiete in Rußland, Skandinavien und im Baltikum seit geraumer Zeit „unlöschbar“ brennen und die Freisetzung von CO2 damit zusätzlich vorantreiben.
Moorschutz ist Klimaschutz. Nach industriell betriebener Abtorfung, großflächiger Entwäs-serung, Umnutzung für Landwirt-schaft und Siedlung, Belastung durch Großvorhaben wie Autobahn- und Flughafenausbau u.v.m. sind in Deutschland nur noch 1 Prozent der Moore unbeeinflusst. Dass das nicht nur für das Klima schlecht ist, versteht sich von selbst.
Durch die Entwässerung der Feuchtgebiete kommt es zu Artenverarmung und Biodiversitäts-verlusten. Moosbeere, Wollgras und Sonnentau verschwinden, viele ans Moor angepasste Schmetterlingsarten sind akut gefährdet, Libellen und Fledermäuse sind ebenso betroffen wie Kreuzotter und Moorfrosch. Die Renaturierung und Wiedervernässung degradierter Moore könnte somit nicht nur einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zum Artenschutz leisten.
Aber auch im heimischen Umfeld ist der vollständige Verzicht oder zumindest eine starke Reduzierung des Torfeinsatzes aus vielerlei Gründen sinnvoll. Somit gilt ab sofort:
Kein Torf in den Topf. Im Internet finden sich viele Beispiele klimafreundlicher Alternativen wie beispielsweise der eigene Kompost.
Steine blühen nicht - Fehlentwicklungen und Tipps
Die neue Lust am Gärtnern ist da. Schrebergärten erleben einen Ansturm wie noch nie, Zeit-schriften über die Idylle des Landlebens boomen und zahllose Gartenbücher erscheinen jedes Jahr rechtzeitig zum Saisonbeginn in den Auslagen der Buchläden. Eine mögliche Erklärung:
Das „Buddeln“ in der Erde, der Anbau von eigenem Obst und Gemüse befriedigt ein Urbedürfnis vieler vor allem in Städten lebender Menschen. Und auch das Gefühl, der Natur etwas zurück-geben und selbst etwas für den Erhalt der Biodiversität tun zu können, scheint ein Motiv zu sein.
Aber Gärtnern ist nicht gleich Gärtnern. Nahezu zeitgleich erreichen Dokutainment-Formate wie „Duell der Gartenprofis“, in dem zwei Gartenbauunternehmer Ideen für vermeintliche Traum-gärten entwickeln und um einen Auftrag kämpfen, ungeahnte Einschaltquoten. Nur: Die dort vorgestellten Konzepte für den lang ersehnten Traumgarten haben mit Natürlichkeit nicht viel zu tun und folgen einem immer gleichen Schema: Überdimensionierte Terrassen verlagern Wohn-zimmer nach draußen, wertvoller Erdboden wird durch Trittplatten, Wege und Grillplatz versiegelt und sogar alte Obstbäume müssen nichtheimischen Gehölzen weichen.
Modern und pflegeleicht soll es sein. Unzählige Tonnen von Natursteinen, deren Herkünfte wegen der damit einhergehenden Landschaftszerstörung hinterfragt gehören, finden ihren Weg als „Rasenmähkante“ oder Hochbeet-Umrandungen in noch so kleine Außenbereiche. Dass bei so viel Einsatz insektenfreundliche Brachen und letzte Wildnisecken in den ansonsten sterilen Neubaugebieten für immer vernichtet werden, scheint weder die Protagonisten noch den Fern-sehsender zu stören.
Rindenmulch, Vliese und Folien zur Rückdrängung von so genannten „Unkräutern“, die es für einen Botaniker gar nicht gibt, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Zum krönenden Abschluss umrandet der immergrüne Kirschlorbeer einen sattgrünen Rollrasen, um wenigstens einen Anstrich von „Grün“ in die neue Außenanlage zu zaubern. Dabei müssten es die gelernten Land-schaftsgärtner doch eigentlich besser wissen. Und ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
mit Bildungsauftrag in Zeiten von Klimawandel und Artenschwund sich seiner besonderen Verant-wortung bewusster sein.
Während viele immer noch mit Giftspritze und Unkrautvernichter in ihren Einheitsgärten mit Thujahecke und Schotterflächen gegen jedes noch so kleine Pflänzchen vorgehen, hat aber zum großen Glück schon längst ein Umdenken eingesetzt. Man kann beinahe von einer Gegenbe-wegung sprechen, denn: Das „natürliche Gärtnern“ wird wieder groß geschrieben. Der Garten wird – endlich - als „ein kleines Stück Umwelt“ betrachtet, als Ökosystem und Lebensraum, in dem es gilt, die biologische Vielfalt zu bewahren und zu fördern.
Bedenkt man, dass in Deutschland etwa 17 Millionen Gärten mit einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratkilometern existieren – das ist das Fünffache der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen (ca. 1.240 Quadratkilometer) – wird klar, wie wichtig natur- und umweltverträgliches Gärtnern wirklich ist.
Tauschbörsen für heimische Wildsamen und Stauden florieren und bieten Naturgärtnern und denen, die es werden wollen, eine willkommene Gelegenheit, gemeinsam Aspekte des biolo-gischen Gärtners zu beleuchten, denn wassersparendes Gießen, richtiges Düngen oder auch das erfolgreiche Kompostieren von Garten- und Küchenabfällen wollen gelernt sein.
Die Natur für sich nutzen, ohne sie zu zerstören. Im Garten leben, sich erholen, ein Garten für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Aber auch ein Garten für Tiere wie Igel und Maulwurf, Vögel, Käfer und Insekten. Der natürliche Garten ist ein gangbarer und unverzichtbarer Weg, im Gleichgewicht mit der Umwelt zu leben und kommenden Generationen ein Stück Natur zu schenken. Packen wir es an!
Mit dem Mähroboter gegen die Artenvielfalt
Vom Einsatz im heimischen Garten wird dringend abgeraten
Das Gras im Garten beginnt zu sprießen. Dazwischen kleine Blüten von Wildkräutern, Maulwurfs-hügel und Ameisenhaufen. Was für Wildbienen, Schmetterlingsraupen und naturbegeisterte Gartenbesitzer eine Freude ist, ist für viele andere ein Ärgernis.
Mit dem Resultat: Es muss gemäht werden. Und zwar sofort und immer wieder, um den Rasen dauerhaft kurz und pflegeleicht zu
halten. Anstatt sich an einem bunten Blumenmeer mit all seinen tierischen Bewohnern zu erfreuen, findet der moderne Gartenpfleger Freude an der Ordnung und einem monotonen Dauergrün aus robusten und
schnittfesten Gräsern. Das Nachsehen hat die Natur.
Zwar schneiden autonome Mähroboter im Vergleich zu anderen Rasenmähern bezüglich der Abgasbelastung, des Stromverbrauchs und der Lärmerzeugung am besten ab, doch sind sie für die Artenvielfalt verheerend.
Kleintiere wie Kröten, Eidechsen, Blindschleichen, Molche und Salamander können den oftmals per App gesteuerten Hochleistungsgeräten kaum entkommen. Einsatzzeiten, Schnitthöhen und Startpunkte sind voreingestellt. Ohne Aufsicht und ohne Rücksicht setzen sie sich in Gang und mähen alles innerhalb eines festgelegten Bewegungsfeldes nieder.
Aus Bequemlichkeit lassen viele Rasenbesitzer den Mähroboter vor allem dann mähen, wenn sie nicht zu Hause sind. Noch beliebter sind die Nachtzeiten, da die strombetriebenen Mähroboter kaum Lärm verursachen. Nicht bedacht wird aber, dass dämmerungs- und nachtaktive Tiere wie Igel genau dann im Garten unterwegs sind, um nach Nahrung zu suchen.
Besonders gefährdet: Junge Igel, die, wenn sie angefahren werden, sich einkugeln und dem Gerät hilflos ausgeliefert sind.
Es stellt sich die Frage, ob wir uns in Zeiten des „galoppierenden“ Artensterbens auf unserem Planeten einen nach menschlichen Maßstäben aufgeräumten Garten mit kurzgeschorenen, englischen Rasen überhaupt noch leisten können. Wir meinen: NEIN.
Denn ein Garten ist doch eigentlich viel mehr als nur ein gelegentlicher Aufenthaltsort für Menschen, die sich auf zubetonierten Terrassen und in sterilen Lounges ihre Wohnzimmer nach außen verlegen, um sich zu erholen.
Ein Garten kann viel mehr. Er ist Lebensraum für viele Pflanzen, ein Biotop für Tiere und leider oft genug schon ein letztes Refugium für seltene und bedrohte Arten. Im Frühjahr ist er die Kinderstube für Singvögel, im Sommer eine Bienenweide und im Herbst wird er langsam zum Winterquartier. Alles dies kann aber nur geschehen, wenn wir es zulassen. Was ist zu tun?
Man wird es kaum glauben, aber die Antwort lautet: Am besten erst einmal nichts. Vielmehr ist vieles zu unterlassen: Das regelmäßige Rasenmähen, das Laub entfernen, das Betonieren von Wegen und anderen Flächen, das Schottern und das ständige Sauber machen. Noch schöner: Nichts tun kostet auch nichts. Weder Zeit noch Geld noch Arbeitskraft.
Aber eines müssen wir doch tun. Unsere Einstellung und unsere Sichtweisen ändern. Fangen wir gleich damit an: Unkräuter gibt es nicht. Jede Pflanze hat ihre Berechtigung und ihren beson-deren Stellenwert im Ökosystem. Nur weil wir den aus Unwissenheit oftmals nicht benennen können, ist das Pflänzchen, was zwischen unseren Pflastersteinen hervorlugt, noch lange kein „Unkraut“.
Vielmehr handelt es sich per Definition um spontane „Begleitvegetation“, die nicht gezielt ange-baut wurde und aus dem Samenpotential des Bodens, über Wurzelausläufer oder über Samen-flug zur Entwicklung kam. Also sind Unkräuter nichts anderes als spontan sprießende Wildkräuter, über deren Auftauchen wir uns eigentlich freuen könnten, da wir sie nicht selbst aussäen müssen.
Und da ist es wieder: Es kostet weder Zeit noch Geld noch Arbeitskraft. Ebenso verhält es sich mit den so genannten Schädlingen. Sie erraten es schon: Schädlinge existieren nur aus der men-schlichen Perspektive heraus. Der umgangssprachliche Begriff ist in erster Linie eine Bezeich-nung für Organismen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Menschen schmälern. Betroffen sind hier natürlich Kulturpflanzungen, die der menschlichen Ernährung dienen. Aber in Ihrem Garten? Sind denn die Schnecken und Spinnen in Ihrem Umfeld wirklich so existenzbedrohend, dass wieder Gift gesprüht werden muss? Wir glauben: NEIN. Vielmehr sind sie wichtiger Teil einer Nahrungskette, die uns natürlich verborgen bleibt, wenn wir uns nicht damit beschäftigen.
Unser Rat. Lassen Sie ab von Rasenmähern und Mährobotern, gönnen Sie sich und Ihrem Rasen eine Auszeit, schauen Sie dem Gras beim Wachsen zu und genießen Sie die Natur im eigenen Garten. Die Artenvielfalt kommt dann von ganz alleine zurück.
Streusalzverzicht lohnt sich - Schutz von Bach und Fluss
Nun ist es wieder soweit. Der Winter ist da und mit ihm Eis und Schnee. Was die einen freut, stellt andere vor ein Problem. Wie Gehwege und Treppen eisfrei halten, ohne die Umwelt zu gefährden?
Hauseigentümer und Mieter sind im Winter grundsätzlich verpflichtet, Zu- und Gehwege vor der eigenen Haustür schnee- und eisfrei zu halten.
Das nennt man Verkehrssicherungspflicht, die im Mietvertrag genauer geregelt sein kann, aber nicht muss. Mit Streusalz ließe sich das Problem für alle Beteiligte ganz schnell lösen.
Schließlich findet man in Baumärkten und anderen Geschäf-ten genug Angebote, um der weißen Pracht und dem frostigen Eisbelag darunter schnell „Herr zu werden“. Doch halt!
In vielen Städten und Gemeinden ist der private Einsatz von Streusalz schon lange untersagt und oft sogar mit einem Bußgeld
belegt. Zu Recht, wie sich noch zeigen wird. Näheres dazu regeln die kommunalen Satzungen. Eine einheitliche Regelung auf Bundes- oder Länderebene existiert derzeit leider nicht.
Streusalz schadet Pflanzen. Gelangt Schmelzwasser
direkt auf Pflanzen, kommt es zu Kontakt-schäden. Noch größerer Schaden entsteht, wenn sich das Streusalz in den Böden am Straßen-rand über viele Jahre anreichert und die Bodenfauna vernichtet.
Feinwurzeln von Bäumen sterben ab, so dass die lebenswichtige Symbiose mit Pilzen (Mykorrhiza) leidet. Die Aufnahme von Nähr-stoffen und Wasser wird erschwert. Die oft schwerwiegenden Folgen machen
sich bei den betrof-fenen Gehölzen zeitverzögert durch Blattrandnekrosen, vorzeitigem Laubfall und bis hin zum Absterben bemerkbar.
Aus den Augen, aus dem Sinn? Wo landet eigentlich
das ganze Streusalz, wenn Schnee- und Eisschmelze einsetzen und der Regen die braune „Brühe“ in den Gully spült? Auf innerörtlichen Straßen mit Regen- oder Mischwasserkanalisation fließt das mit
Streusalz versetzte Schmelz-wasser in das Kanalsystem. Nachdem es die Kläranlage passiert hat, gelangt es in Bäche und
Flüsse.
Bei einer Überlastung der Mischwasserkanalisation durch starke Regenfälle beispielsweise kann es geschehen, dass das Streusalz auch direkt mit dem Schmutzwasser in unseren Oberflächen-gewässern landet. Auf überregionalen Straßen dringt etwa die Hälfte des Salzes über verspritztes Schneewasser in die Böden am Straßenrand ein. Der Rest kommt mit dem Schmelzwasser in die Straßenentwässerung und wird entweder versickert oder ebenfalls in Oberflächengewässer ein-geleitet. Dies ist immer mit schlimmen Folgen für das Ökosystem, die Fischfauna und Gewässer-organismen wie Krebse, Insektenlarven u.v.m. verbunden.
Außerdem gelangt salzhaltiges Schmelzwasser durch Versickerung in unser Grundwasser.
Da Grundwasser sich aber nur sehr langsam erneuert und unsere wichtigste Trinkwasserquelle darstellt, sollten Beeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden werden.
Was ist zu tun? Es kommt auf Ihre Schnelligkeit an.
Je eher Sie mit dem Schneeschippen begin-nen, desto leichter ist es, denn der Schnee ist noch nicht festgetreten oder vereist. Außerdem kann auf Streumittel ganz verzichtet werden. Wenn sich deren
Einsatz aber nicht mehr verhindern lässt, sollte man ausschließlich auf salzfreie, abstumpfende Streumittel wie Sand, Splitt oder Granulat, die im Handel an dem Umweltzeichen Blauer Engel erkennbar sind, zurückgreifen. Diese Streumittel können Sie nach der Schneeschmelze
zusammenfegen und beim nächsten Schneefall wiederverwenden.
Zügiges Schneeschippen hat aber noch andere Vorteile. Die gesetzliche Räumungspflicht, die zumeist eine Räumung bis spätestens 7 Uhr am Werktag vorsieht, ist erfüllt, der Frühsport schnell erledigt und man kann sich einem gemütlichen und auch wohlverdientem Frühstück widmen.