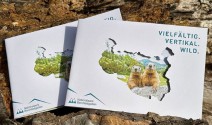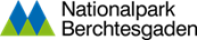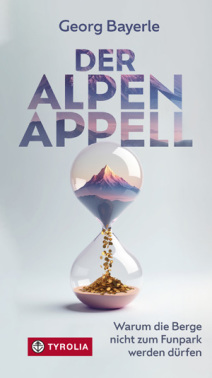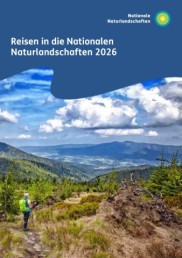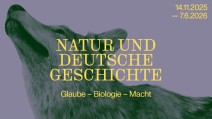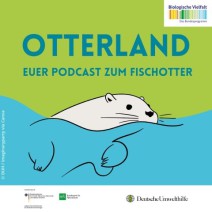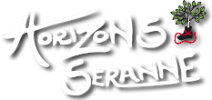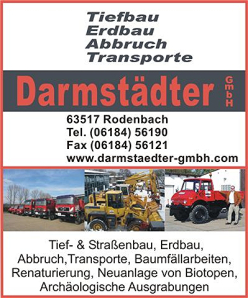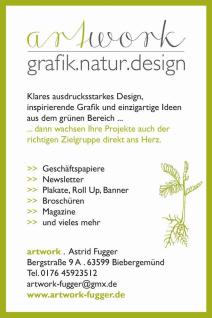16. Juli 2025
Wiederbewaldung und Waldentwicklung Harz:
Natur für uns arbeiten lassen
NABU Niedersachsen unterstützt das Landesprogramm zur Wiederbewaldung
________________________________________________________________
Hannover – Am 14. Juli 2025 hat der Verwaltungsrat der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) das „Programm zur Wiederbewaldung und Waldentwicklung Harz“ (WBP Harz) beschlossen. Damit ist der Weg frei für eines der größten Natur-Wiederherstellungs-projekte in der Geschichte Niedersachsens.
Mit 130 Millionen Euro versetzt die Landesregierung die Niedersächsischen Landesforsten in die Lage, auf über 270 Quadratkilometern abgestorbener Fichtenmonokulturen die Wiederbewaldung so zu lenken, dass anpassungsfähige, naturnahe Wälder entstehen können. Die Fläche nimmt damit mehr als die Hälfte des niedersächsischen Landeswaldes im Harz (540 Quadratkilometer) ein. Der NABU Niedersachsen begrüßt, dass das neue Landes-Programm die Selbstheilungs-kräfte der Natur durch gezielte Investitionen zur Wiederherstellung des niedersächsischen Harzwaldes unterstützt.
Naturnahe Waldentwicklung verbessert Trinkwasser- und Klimaschutz
Prof. Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen erklärt dazu:
„Für die Menschen in Niedersachsen ist es wichtig, dass das Wiederherstellungsprogramm den gesamten Harz in den Blick nimmt. Der Anteil der Laubwälder soll künftig auf 58 Prozent steigen, der der
Laubbäume auf rund zwei Drittel. Beides ist dringend erforderlich, um den Wald an den Klimawandel anzupassen und die Qualität des Trinkwassers dauerhaft zu sichern. In den Berg-wäldern des Harzes
wird die Buche wieder zur wichtigsten Baumart werden. In den Hochlagen soll die Fichte trotz steigender Temperaturen in den vorgesehenen 28 Prozent Nadelwald ihre natürliche Rolle behalten. Um das
geschwächte Ökosystem insgesamt zu stabilisieren, wird auf die Integration der bereits weit verbreiteten Pionierbaumarten wie Vogelbeere, Birke, Salweide und Espe gesetzt. Gleichzeitig sollen
Mischbaumarten wie Bergahorn und Traubeneiche gezielt gefördert werden. Den wachsenden Anteil der oft geschwächten Douglasien und auch den verstärkten Einsatz von Großmaschinen sehen wir zwar
kritisch. Insgesamt scheint jedoch Maß gehalten und das Programm ist aus unserer Sicht ausgewogen genug, um Risiken zu begrenzen und Chancen bestmöglich zu nutzen.“
Noch wichtiger als das Pflanzen neuer Bäume ist der Erhalt und die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, vor allem des Humus. Nur so haben junge Bäume unter den Bedingungen des Klimawandels eine gute Überlebenschance, und gleichzeitig wird der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2, Lachgas und Methan aus dem Waldboden wirksam verhindert. Die aktuell massive Verfehlung des gesetzlichen Klimaschutzziels für den Sektor Landnutzung (LULUCF) zeigt, wie dringend hier gehandelt werden muss. Deshalb sieht das Programm keine herkömmliche Flächenräumung vor. Nur dort, wo sich eine Waldverjüngung sonst nicht entwickeln kann, werden einzelne Streifen oder rundliche Kleinflächen schonend vorbereitet. Auch soge-nannte Schlagabraum-Wälle, die Schadstoffe ins Grundwasser abgeben, Treibhausgase pro-duzieren und unnötige Humus- und Nährstoffverluste verursachen, sollen der Vergangenheit angehören. Stattdessen soll die wertvolle Biomasse weitgehend in den Flächen gehalten werden.
Ein vielfältiges Mosaik statt monotoner Aufforstungen
Außerdem werden die Landesforsten den aktuell beeindruckend blühenden, reich fruchtenden und von Insekten umschwirrten Offenflächen Raum
gegeben werden: Auf über 20 Prozent der Wiederbewaldungsfläche bestimmt die natürliche Sukzession die Entwicklung. Die zusammen-brechenden Fichten des "Dürrständer-Konzeptes" bieten
Struktur und wertvolles Totholz. Waldwiesen werden vergrößert und mit Harzer Bergwiesen-Saatgut aufgewertet. Prägend wird eine besonders großzügige Gestaltung der Waldinnenränder mit viel Platz und
aufwändiger Pflanzung einer heimischen Strauchvielfalt.
So entsteht keine monotone, gleichaltrige Aufforstung, sondern ein abwechslungsreiches, lichtes bis schattiges Vegetationsmosaik. Dieses vielfältige Gefüge erhält die biologische Vielfalt und stärkt damit die Fähigkeit des Waldes, sich an den Klimawandel anzupassen – die sogenannte Resilienz. Gleichzeitig bleibt der Harz auf diese Weise auch für den Tourismus attraktiv.
Dr. Carsten Böhm, stellvertretender Vorsitzender des NABU Niedersachsen, ist trotz aller Unwägbarkeiten überzeugt: „Künftige Generationen werden bei der Bewertung dieses Programms zur Wiederbewaldung und Waldentwicklung des Harzes zu der Auffassung gelangen, dass nach bestem Wissen und Gewissen geplant und gehandelt wurde. Zu diesem Schluss werden sie leider wohl nicht oft kommen. Umso wichtiger ist es, dass das Land Niedersachsen hier auf vorbildliche Weise seiner Verantwortung gerecht wird.“
-------------------------------------------------------------------------
Quelle: NABU Niedersachsen