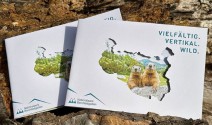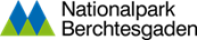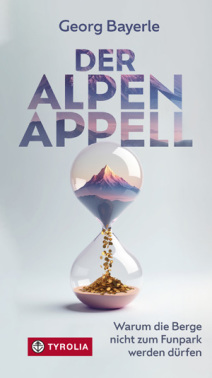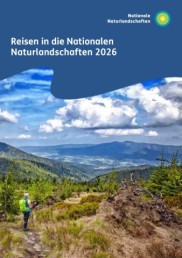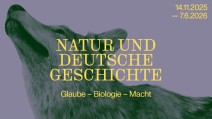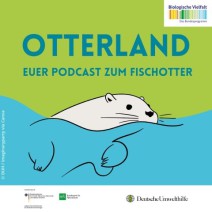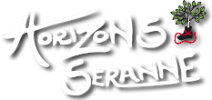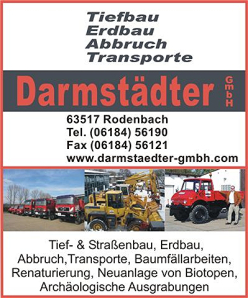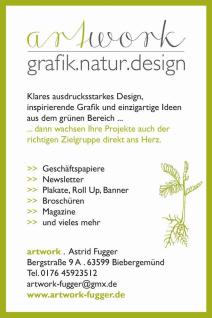13. November 2025 | Ausstellung
Natur und deutsche Geschichte
Glaube – Biologie – Macht
Ab dem 14. November 2025 im Deutschen Historischen Museum
Was ist gemeint, wenn von „Natur“ die Rede ist? Auf diese Frage sind in der deutschen Geschichte sehr unterschiedliche Antworten gegeben worden. Regierungen sowie religiöse und politische Bewegungen haben den Begriff der Natur definiert – und für sich beansprucht. In einer neuen Ausstellung zeigt das Deutsche Historische Museum, wie unterschiedlich „Natur“ zu verschiedenen Zeiten im Spannungsfeld von Glaube, Biologie und Macht verstanden und politisch eingesetzt wurde. Der schillernde und vielseitige Begriff der „Natur“ wird in seiner historischen Breite und Tiefe ausgelotet.
Die Ausstellung blickt vom 14. November 2025 bis 7. Juni 2026 auf Beispiele aus 800 Jahren deutscher Geschichte zurück: Ausgehend von Hildegard von Bingens Begriff der göttlichen „Grünkraft“ im 12. Jahrhundert spannt die Kuratorin Julia Voss den Bogen bis zu den Naturkonzepten im geteilten Deutschland, der Umweltpolitik und der frühen Anti-Atomkraft-Bewegung der 1970er Jahre.
Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum: „Die Frage, was als ,natürlich` zu definieren sei, nahm auf der politischen Bühne immer größeren Raum ein und ging Hand in Hand mit der Aufwertung und Abwertung von Personen, Gruppen, Ländern oder Nationen. Die Regeln und Normen, die etabliert werden sollten, wurden als ,natürlich` verklärt. Es erscheint uns deshalb wichtig, immer wieder neu zu fragen, was in der deutschen Geschichte jeweils unter ,Natur` verstanden wurde – und mit welchen Folgen. Ich hoffe, wir können mit diesem historischen Blick auf einen zentralen Begriff deutscher Geschichte unsere gegenwärtigen Diskussionen um eine wichtige Perspektive erweitern: eine, die schnell übersehen wird, wenn alles, was mit ,Natur` verbunden wird, entweder in ein konservatives oder ein progressives, ein linkes oder ein rechtes Schema gepresst wird.“
Julia Voss, Kuratorin der Ausstellung: „Die Vorstellungen von ‚Natur‘ haben in der Geschichte immer wieder neue und andere Gestalt angenommen: in Gemälden, Globen, Karten, Büchern, Modellen, Fotografien oder Filmen. Wir haben Objekte aus 800 Jahren zusammengetragen. Wir hoffen, dass sie in der Ausstellung dazu anregen, sich zu fragen, welche Bedeutung Natur für einen selbst hat.“
Nach einem Prolog werden in der Ausstellung historische Etappen dieses Bedeutungswandels durchschritten: In fünf chronologisch angeordneten Themenräumen öffnen verschiedene Stationen historische Fenster auf Ereignisse oder Entwicklungen, in denen das Naturverständnis markant geprägt oder verändert wurde. Diese Stationen werden jeweils mit einem Tier oder einer Pflanze eingeleitet. Die Ausstellung rückt dabei unterschiedliche Landschaften in den Fokus: von den Kulturlandschaften des Mittelalters über die Wüstungen des Dreißigjährigen Krieges und den im 19. Jahrhundert zum Mythos aufgestiegenen „deutschen Wald“ bis zu den Lausitzer Tagebaulandschaften in der DDR im 20. Jahrhundert.
Am Beginn der Ausstellung stehen die Werke der Äbtissin und Benediktinerin Hildegard von Bingen. Gemäß ihrer Theologie sollte sich der Mensch des Mittelalters in den Dienst der göttlichen „Grünkraft“ – lateinisch „viriditas“ – stellen, um die Frische der natürlichen Welt wiederzubeleben und erstarken zu lassen. „Natur“ war für die Visionärin Schöpfung, vom Kosmos über alles Lebende bis zu den Flüssen und Steinen. Dieses Verständnis teilte auch Konrad von Megenberg in seinem „Buch der Natur“ aus dem 14. Jahrhundert, das als erstes systematisches deutschsprachiges Kompendium der geschaffenen Natur gilt. Am Beispiel der Bodenseefischerei zeigt die Ausstellung, wie schon im Spätmittelalter mit kooperativen Allmenden erfolgreich auf begrenzte Fischbestände reagiert wurde.
Die von dem Astronomen Johannes Kepler beschriebenen Planetenbewegungen, die „Kartoffel-befehle“ des preußischen Königs Friedrich II. oder der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora, der 1816 das „Jahr ohne Sommer“ einläutete, illustrieren beispielhaft, wie sich in der von Kriegen, Missernten und Seuchen geplagten frühen Neuzeit das Verständnis von einer regelhaften Natur entwickelte, die göttlichen Gesetzen unterworfen war und zugleich systematisch erforscht und als Ressource nutzbar gemacht werden konnte.
Im 19. Jahrhundert stieg „Natur“ zu einem Schlüsselbegriff politischer Bewegungen auf: Der berühmte Zoologe und Anhänger der Evolutionstheorie Ernst Haeckel etwa benannte nicht ohne Hintersinn eine neue Art nach Reichskanzler Otto von Bismarck – „Alacorys bismarckii“. Der mikroskopisch kleine Organismus aus der Gruppe der Strahlentierchen war aus dem westlichen Pazifik gefischt worden. Inwiefern Natur und Kultur im Zuge der industriellen Revolution zunehmend als Gegensätze verstanden wurden, verdeutlicht die Schau unter anderem anhand der Entstehung der ersten staatlichen Einrichtungen zum Schutz bedrohter „Naturdenkmale“. Zugleich wurde in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft diskutiert, was als „natürlich“ zu gelten habe. So sah der Pädagoge Friedrich Fröbel die Natur als beste Lehrmeisterin für ein friedliches Miteinander an und gründete 1840 eine neuartige Einrichtung: den Kindergarten. Der preußische Staat reagierte zunächst mit einem Verbot, zu revolutionär und atheistisch erschien ihm die „natürliche“ Kleinkinderziehung.
Keine politische Bewegung in der deutschen Geschichte war so besessen von der Idee, die Norm einer „deutschen Natur“ zu schaffen, wie der Nationalsozialismus. Die Ausstellung thematisiert, wie ab 1933 Bevölkerungen und Landschaften mit brutalen Mitteln diesem ideologischen Naturbegriff unterworfen wurden. Die „Nürnberger Gesetze“ und das „Reichsnaturschutzgesetz“ waren aufeinander bezogen und wurden im gleichen Jahr erlassen: 1935.
In den 1970er Jahren zeigten sich in beiden deutschen Staaten die Folgen der industriellen Tierhaltung, intensiv bewirtschafteten Landschaften und verschmutzten Luft. Als Antwort darauf entstand ein neues Wort: „Umweltschutz“. Die Ausstellung endet mit einer der ersten demokratischen Bewegungen für den „Umweltschutz“: Die Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung von Wyhl protestierten gegen den Bau eines Atomkraftwerks und wurden zum Vorbild für politische Bewegungen von Japan bis in die USA. Im gleichen Zeitraum erhielt in der Bundesrepublik der „Umweltschutz“ unter Hans-Dietrich Genscher erstmals eine eigene Abteilung im FDP-geführten Innenministerium.
Ausgewählten Debatten um den Naturbegriff und Stationen seiner fortlaufenden Transformationen geht die Ausstellung in rund 250 Objekten nach. In aktuellen Videointerviews nehmen die Historikerinnen und Historiker David Blackbourn, Nils Franke, Annette Kehnel, Ulinka Rublack, Veronika Settele und Nikolaus Wachsmann das Naturverständnis der vorgestellten Zeiträume jeweils in den Blick.
Die Untersuchung geht über die Fokussierung auf Themen des Natur- oder Umweltschutzes hinaus, die in Zeiten des Klimawandels häufig ins Zentrum gestellt werden. Gegenstand der Betrachtung sind nicht alleine die gegenwärtige Aufladung und die heutige semantische Bedeutung von „Natur“, sondern die sich verändernden Vorstellungen in der deutschen Geschichte. Die heutigen Debatten sollen durch die historischen Perspektiven bereichert werden.
Die Ausstellung ist inklusiv und weitgehend barrierefrei gestaltet. Multisensorische und interaktive Stationen ergänzen die Ausstellungsthemen und beziehen die Besucherinnen und Besucher aktiv mit ein: So werden etwa die Düfte einiger Pflanzen, deren Wirkkräfte Hildegard von Bingen beschrieb, an Riechstationen erfahrbar gemacht. Eine Kinderspur durch die Ausstellung und Familienführun-gen laden auch junge Museumsgäste zum Ausstellungsbesuch ein. Eine Hörführung auf Deutsch und Englisch bietet Hintergrundinformationen zur Ausstellung und zu ausgewählten Objekten.
Die Ausstellungsgestaltung fungiert als ein erster Testlauf im Sinne nachhaltigen Ausstellens: Für die Architektur wurden möglichst viele Materialien aus früheren DHM-Ausstellungen wiederverwendet. Die Mehrzahl der gezeigten Objekte stammt aus den DHM-Sammlungen, die Transporte von Leih-gaben aus Museen und Archiven in ganz Deutschland wurden gebündelt.
Zur Ausstellung erscheint im Verlag Matthes & Seitz Berlin eine reich bebilderte Publikation in deutscher Sprache mit wissenschaftlichen Beiträgen, Interviews mit Historikerinnen und Historikern sowie historischen Rezepten. Das digitale DHM-Format More Story führt auf Deutsch und Englisch in die Ausstellung ein und bietet ausführliche Hintergrundinterviews und -informationen. Ein breit-gefächertes Begleitprogramm aus bundesweiten Spaziergängen, Tandemführungen durch die Ausstellung und einer Filmreihe des Zeughauskinos vertieft und ergänzt während der Laufzeit die Themen der Ausstellung.
Quelle: Deutsches Historisches Museum